
Hintergrund
Dein Kind kommt in die Vorpubertät: Lass es los, aber nicht fallen
von Mareike Steger

Plötzlich ist das Kind ein Schulkind – und als Eltern kommen ganz neue Fragen auf. Der oberste Schulpsychologe der Stadt Zürich gibt Antworten.
Gerade noch hatte ich ihn wie ein kleines Kängurubaby durch die Welt getragen. Und nun stand er strahlend vor dem grossen Schulhaus. Wandte sich mir zu, drückte mir seine Schultüte in die Hand und raunte mit vielsagendem Blick: «Mama, nimm du die!» Die anderen Kinder hatten keine dabei. So ging die Schullaufbahn meines Kindes plötzlich los und ich hatte schon den ersten Fehler begangen.

Ich merkte schnell, dass die Schultüte nicht die einzige Frage bleiben würde, die mich als frischgebackene Schulkindmama beschäftigen sollte. Die Frage aber, die mich selbst am brennendsten zu interessieren begann: Wie merke ich, dass es meinem Kind in der Schule wirklich gut geht – und was kann ich tun, damit das so bleibt?
Weil es vielen Schulkindeltern gleich geht, habe ich mich mit Matthias Obrist, Leiter des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt Zürich und Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie, zum Gespräch getroffen. Matthias empfing mich in seinem Büro im Zürcher Schulamt. Am Besprechungstisch erklärte er mir unter anderem, wann Eltern bei den Hausaufgaben helfen und wann sie besser ruhig bleiben sollten – und was Kinder sonst noch für die Schullaufbahn stärkt.
Allein im Kanton Zürich sind im August rund 15 000 Kinder in die Schule gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass es beim Schulpsychologischen Dienst gerade brennt, kurz nach dem Schulstart …
Matthias Obrist: Die allermeisten Kinder schaffen die Umstellung vom Kindergarten in die Schule gut. Sie sind stolz, nun Schülerin oder Schüler mit neuer Leuchtweste und Schulthek zu sein. Wir haben aber durchaus einige, wenn auch nicht dramatisch viele Anmeldungen, weil Kinder überfordert und verunsichert sind.
Was sind für Kinder die grössten Herausforderungen beim Übergang vom Kindergarten in die 1. Klasse?
Der soziale Vergleich steigt. Es kommt vor, dass ein Kind nicht in die Schule gehen will, weil es das Gefühl hat, nicht so gut wie die anderen zu sein. Manchmal entstehen auch Ängste, weil der neue Schulweg und das grosse Schulhaus mit 200 bis 300 älteren Kindern auf dem Pausenplatz ungewohnt sind.
Ich habe mal gehört, dass Kinder oft motiviert starten und vor den Herbstferien in ein Tief rutschen. Wie schätzt du das ein?
Es gehört ein Stück weit dazu, dass sich die Anfangseuphorie nach ein paar Wochen legt. Der Schritt vom Spiel- zum Lernkind ist gross und anstrengend. Kinder brauchen Ausdauer und eine gewisse Frustrationstoleranz, bis sie die abstrakten Regeln beim Lesen und Rechnen verstehen. Ausserdem sind die Tage länger als im Kindergarten, wo es mehr Rückzugsmöglichkeiten und offene Sequenzen gibt. In der Schule gibt es einen strukturierten Stundenplan und nach der Schule noch Hausaufgaben zu erledigen.
Die Hausaufgaben sind ein gutes Beispiel für ein Thema, mit dem man sich als Mutter oder Vater noch nie befasst hat, bevor das erste Kind in die Schule kommt. Da kommen ganz neue Fragen auf: Soll ich das Kind bei den Hausaufgaben begleiten oder es selbst machen lassen?
Ja, auch für die Eltern ist der Schuleintritt eine Umstellung. Die Lehrpersonen erklären die Hausaufgaben in der Schule so, dass die Kinder sie selbstständig machen können. Das stärkt auch ihr Selbstvertrauen.
Und wenn ein Kind selbst nicht weiterkommt?
Dann kann man gut Hilfe anbieten. Man hält sich grundsätzlich während der Hausaufgaben im Hintergrund, ist aber da, wenn das Kind einen braucht. So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Wenn ein Kind wiederholt Mühe mit den Hausaufgaben hat, sollten Eltern sich an die Lehrperson oder die Heilpädagogin in der Schule wenden. Sie haben gutes pädagogisches Lehrmaterial, das unterstützen kann. Wichtig finde ich, dem Kind gegenüber Zuversicht auszustrahlen, im Sinne von: «Du wirst das schon lernen. Wir haben Zeit und gehen in deinem eigenen Tempo.» Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.
Der Austausch zwischen Lehrpersonen und Eltern funktioniert ja nicht immer reibungslos. Was kann man in so einem Fall tun?
Dranbleiben. Manche Lehrer wollen ihr Programm vielleicht nicht für ein einziges Kind anpassen. Aber das ist zu kurz gedacht. Es gibt in jeder Klasse Kinder, die nicht in die Durchschnittsnorm passen und anspruchsvollere oder weniger anspruchsvolle Aufgaben als der grosse Rest benötigen. Stimmt eine Lehrperson Lehrinhalte individuell auf den Kenntnisstand der Kinder ab, hat sie am Ende sogar weniger zu tun. Denn so lernen die Kinder motiviert und stiften keine Unruhe. Für die Lernmotivation sind Zufriedenheits- und Erfolgsinseln wichtig. Das kann natürlich auch privat neben der Schule passieren, zum Beispiel bei einem Hobby.
Woran erkennen Eltern, dass ihr Kind Hilfe braucht?
Bei Schulanfängern ist auffällig, wenn ein Kind nur mit Unmut in die Schule geht. Oder wenn ein Kind nicht gut schläft, bedrückt wirkt oder geladen von der Schule heimkommt und den Thek in die Ecke pfeffert.
Wie verhält man sich in solch einer Situation?
Ruhig bleiben, gut zuhören und beobachten. Manchmal erzählen die Kinder etwas oder malen, was sie bedrückt. Wichtig finde ich, die Stimmung ernst zu nehmen und lieber früher als später das Gespräch mit der Schule zu suchen. Manchmal zeigen Kinder ihren Unmut nur zuhause, weil sie sich in der Schule anpassen. Das ist für die Lehrperson wichtig zu wissen. Auch wenn man das Verhalten eines Kindes zuerst nicht versteht, sollte man sich bewusst machen, dass es für jedes Verhalten einen guten Grund gibt, der oft erst mit der Zeit klar wird.
Erlebst du, dass Eltern eine Hemmschwelle haben, sich an den Schulpsychologischen Dienst zu wenden – vielleicht aus Sorge, dass mit ihrem Kind etwas nicht «normal» sein könnte?
«Die Eltern» gibt es ja nicht. Manche haben Vorbehalte gegenüber der Beratung durch eine fremde Person. Andere sind froh, dass es über die Lehrperson hinaus eine Instanz gibt, die helfen kann. Wieder andere Eltern haben das Gefühl, man könnte bei jedem Kind Wunder vollbringen, wenn man nur eine Diagnose stellt und die richtigen Massnahmen ergreift. Insgesamt aber hat sich die Einstellung zur Schulpsychologie positiv entwickelt. Gleichzeitig können wir, da wir keine private Praxis sind, unsere Kapazitäten nicht ausbauen. Leichtere Schwierigkeiten müssen deshalb leider länger warten.
Wie stuft ihr da ab – welche Fälle gelten als leichter und welche als akut?
Wenn ein Kind über längere Zeit wiederholt nicht in die Schule gehen will oder massiv den Unterricht stört, sind schnelle Massnahmen gefragt. Auch das Thema Sonderschulung und Konflikte zwischen Schule und Eltern gelten als dringend. Ein Kind, dem es nicht so gut geht, das aber noch zur Schule geht, müssen wir als weniger akut einstufen.
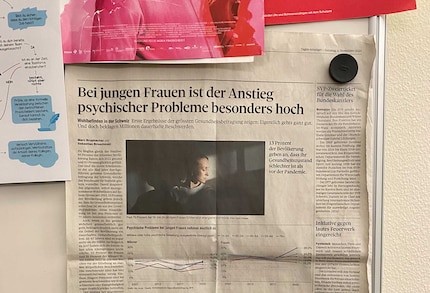
Du bist seit 30 Jahren als Schulpsychologe tätig. Was hat sich in Sachen psychischer Gesundheit in den Schulen in dieser Zeit verändert?
Bei den Jugendlichen hat sich die psychische Gesundheit verschoben in Richtung mehr Angst und Depression, vor allem bei Mädchen. Diese Entwicklung sollten wir im Blick behalten. Ich will aber auch betonen, dass es 90 Prozent der Jugendlichen gut geht. Bei den Kindern verfügen wir über weniger Zahlen. Schön finde ich, dass das Bewusstsein über psychische Gesundheit grösser geworden ist – und wir mehr darüber sprechen.
Wie stärken Eltern ihr Kind schon gleich zu Beginn für die Schullaufbahn?
Eltern tun gut daran, ihrem Kind Interesse entgegenzubringen und bei Problemen Sicherheit zu vermitteln: «Du schaffst das und ich bin für dich da.» Insgesamt finde ich, sollten Eltern ihren Kindern ruhig mehr zutrauen. Raus in den Dreck zu gehen und mit Erregern in Kontakt zu kommen, stärkt das physische Immunsystem. Genauso stärkt es die psychische Resilienz, wenn sich ein Kind auch mal mit kleinen Widrigkeiten auseinandersetzt – und das schafft.
Wenn du dir etwas wünschen dürftest: Was müsste sich an unseren Schulen verändern?
Ich wünsche mir, dass das sozial-emotionale Lernen in der Schule denselben Stellenwert bekommt wie Lesen, Rechnen und Schreiben. Kinder sollten noch besser lernen, sich selbst wahrzunehmen, mit Gefühlen umzugehen und gut mit anderen auszukommen. Einiges läuft schon in diese Richtung, aber da geht noch mehr.
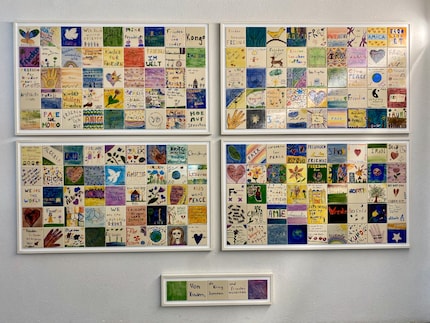
Eigentlich bin ich Journalistin, in den letzten Jahren aber auch vermehrt als Sandkuchenbäckerin, Familienhund-Trainerin und Bagger-Expertin tätig. Mir geht das Herz auf, wenn meine Kinder vor Freude Tränen lachen und abends selig nebeneinander einschlafen. Dank ihnen finde ich täglich Inspiration zum Schreiben – und kenne nun auch den Unterschied zwischen Radlader, Asphaltfertiger und Planierraupe.
Interessantes aus der Welt der Produkte, Blicke hinter die Kulissen von Herstellern und Portraits von interessanten Menschen.
Alle anzeigen