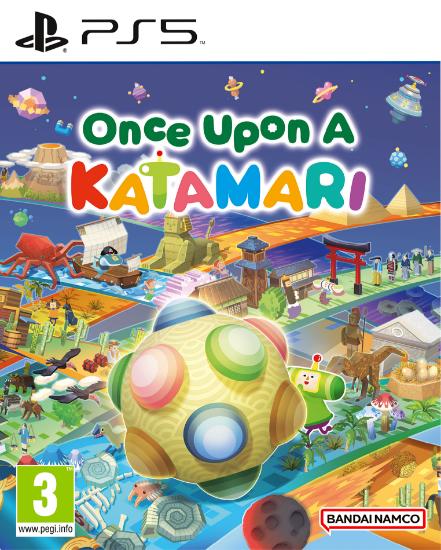

«Once Upon a Katamari»: durchgeknallt im All
14 lange Jahre mussten wir auf einen neuen Teil des Puzzle-Games warten. «Once Upon a Katamari» liefert Chaos, simples, aber grossartiges Gameplay und einen König, der dich nach jedem Level wissen lässt, wie enttäuschend mittelmässig du bist. Was will man mehr?
«Once Upon a Katamari» ist bizarr. Angefangen vom Design, über die Charaktere bis hin zum sehr eigenwilligen Spielprinzip. Selbst in der heutigen Zeit, in der sich Indie-Entwickler regelmässig mit den absurdesten Prämissen übertreffen, steht das Puzzle-Spiel weitgehend alleine da. Ich liebe es. Und ich hasse es ein bisschen.
Als ich den Gaming-Fiebertraum zum ersten Mal starte, habe ich ein massives Déjà-vu. Die Story fühlt sich seltsam vertraut an. Sie beginnt mit einem ziemlich grossen Oopsie von einer Gottheit, dem «King of all Kosmos». Der Monarch ist hochgradig exzentrisch (und genauso bescheuert) und zerstört während einer improvisierten Jongliereinlage mal eben sämtliche Planeten.
So einen wirren Plot vergisst man eigentlich nicht.Ein kurzer Wiki-Check verrät, dass der König einigermassen regelmässig das Universum rebootet. Mal weil er betrunken ist, mal weil sein Tennisaufschlag daneben geht. «Once Upon a Katamari» setzt die Tradition fort, erweitert die Synopsis um einen zusätzlichen Zeitreise-Plot. Dieser ergibt genauso viel Sinn, wie der Rest der Geschichte, nämlich gar keinen.
Die Konsequenzen seines Missgeschicks überlässt der Chaot ein weiteres Mal seinem winzigen Sohn – dem Prinzen – in dessen Rolle ich schlüpfe. Und «Rollen» ist auch das Credo des Spiels.
They see me rollin’ …
Der Wiederaufbau des Universums erfolgt mit dem titelgebenden Katamari, einer klebrigen Kugel, an der alles hängen bleibt, was kleiner als sie ist. Je nach Level sind das zu Beginn Büroklammern, mein Selbstbewusstsein, Shotgläser oder ähnlich winziges Zeugs. Jeder eingefangene Gegenstand lässt meinen Katamari weiterwachsen und erweitert damit meine Sammelfähigkeit.

Quelle: Bandai Namco
Aus Shotgläsern werden Bierhumpen und aus Bierhumpen werden Fässer. Je grösser der Ball, desto grösser die Dinge. Irgendwann verschlinge ich Katzen, dann Menschen, dann Häuser, und am Ende ganze Stadtteile. Es ist das klassische Schneeball-Prinzip: Ich rolle eine Kugel. Die Kugel wird grösser.
Power-Ups helfen dabei. Ein Magnet erweitert den Radius, Raketen geben einen Geschwindigkeits-Boost und ein Radar deckt versteckte Collectibles auf. Dazu weiter unten mehr.
Einmal um die Welt
Der Zeitreise-Plot erlaubt «Once Upon a Katamari» die bisher abwechslungsreichste Auswahl an Levels der Franchise. Ich kullere durch das feudale Japan, das prähistorische Dino-Zeitalter und weitere Epochen, die allesamt angenehm divers daherkommen.

Quelle: Bandai Namco
Ähnlich unterschiedlich sind auch die Zielsetzungen innerhalb Levels, auch wenn das Prinzip im Grundsatz immer das gleiche bleibt: Rollen. Oft bin ich dafür an ein enges Zeitlimit gebunden, was das Ganze zu einem hektischen Rennen gegen die Uhr macht.
Bedauerlicherweise gehen im Stress die vielen witzigen Details in der Spielewelt manchmal ein bisschen unter. Wer aufpasst, findet an nahezu jeder Ecke eine schräge Szene – Hunde mit römischen Helmen, Fangen spielende Cowboys und mehr unterstreichen das exzentrische Konzept von «Once Upon A Katamari», sofern du es denn mitbekommst.

Quelle: Bandai Namco
Ebenfalls gut versteckt sind die Collectibles. Am wichtigsten sind die Kronen des Königs, die fortlaufend neue Levels freischalten. Fans der Serie freuen sich besondersüber die Rückkehr der Cousins, von denen es im Spiel insgesamt 69 Stück (nice!) gibt. Die Verwandten des Prinzen sind allesamt spielbar, machen aber keinen Unterschied beim Gameplay. Dazu gibt es allerlei kosmetischen Krams, um meinen eigenen Cousin zu basteln und um das Raumschiff, das mich von Epoche zu Epoche fliegt, etwas aufzupeppen.
Nett, aber eigentlich egal.
Akustisch hui, optisch naja
Überhaupt nicht egal ist hingegen der Soundtrack. Unzählige funky J-Pop-Banger begleiten das Gameplay – herrlich durchgeknallte Ohrwürmer, die sich in den Gehörgängen einnisten und lange, nachdem die Konsole aus ist, dort sitzenbleiben. Die Musik ist kreativ, abwechslungsreich und passt perfekt zur absurden Atmosphäre des Spiels.
Optisch kann «Once Upon a Katamari» nicht ganz mithalten. Die Grafik ist durchaus charmant und wie bereits erwähnt, gibt es viel zu entdecken. Von einer rein technisch-nüchternen Seite betrachtet fällt das Spiel aber klar durch. Grafisch wäre das auch auf der PS3 möglich gewesen.
Ob das eine bewusste Entscheidung war oder die Nintendo Switch-Version daran Schuld ist, wissen wahrscheinlich nur die Entwickler.

Quelle: Bandai Namco
Alles unter Kontrolle?
«Katamari» hat eine loyale Fanbase und die werden sich wahrscheinlich in den Kommentaren über meine Ansicht auslassen: Die Default-Steuerung des Spiels, bei der mitden beiden Sticks gerollt wird, ist kacke.
Das war beim ersten Teil 2004 der Fall und das ist es bis heute geblieben. Der Prinz lenkt sich wie das mieseste ferngesteuerte Auto der Welt.In Kombination mit der eigenwilligen Physik des Games und der bockigen Kamera in engen Räumen wird daraus eine frustrierende Geduldsprobe.
Entwicklerstudio Rengame hat allerdings Mitleid mit überforderten Gamern wie mir und spendiert «Once Upon a Katamari» eine vereinfachte Kontroll-Option. Das entschärft die Situation ein wenig, eine steile Lernkurve bleibt dennoch.

Quelle: Bandai Namco
An dieser Stelle eine Warnung, für alle, die schwindelanfällig sind: Die ständige Rotation des Balls, die schnellen Kamerawechsel und das hektische Gameplay können bei empfindlichen Spielerinnen und Spielern zu Übelkeit führen. Wer rollen will, braucht einen starken Magen.
Eine Audienz beim König
Meine Leistung wird nach jedem Level bewertet. Allerdings nicht von einem neutralen Scoreboard oder von einem wohlwollenden Mentor – das Feedback kommt vom King of All Cosmos höchstpersönlich und der Typ ist ein kolossaler Arsch.
Egal, wie gut ich mich anstelle, der König findet immer einen Grund, mich niederzumachen. «Hast du es überhaupt probiert?», «enttäuschend», «das geht besser» – seine Kommentare sind brutal und unterhaltsam zugleich. Es ist diese absurde Mischung aus nonchalantem Grössenwahn und passiv-aggressiver Dad-Energy, die den Monarchen zu einer der denkwürdigsten Videospiel-Figuren überhaupt macht.

Quelle: Bandai Namco
Sein Peptalk sorgt ausserdem dafür, dass ich die Motivation auch dann nicht verliere, wenn ich einen Level zum dritten Mal in Folge verbockt habe.
Danke, Daddy.
«Once Upon a Katamari» ist ab dem 24. Oktober erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch. Ich habe die PS5-Pro-Version getestet, die mir von Bandai Namco zur Verfügung gestellt wurde.
Fazit
Aus der Zeit gefallen und das ist gut so
«Once Upon a Katamari» ist ein Zeitreise. Im direkten, sowie im indirekten Sinn. Das erste neue Mainline-Game seit 2011 spielt sich praktisch gleich wie das Serien-Debüt anno 2004. Klar, optisch kommt alles etwas schicker daher und das Gameplay hat ein bisschen Finetuning bekommen. Darüber hinaus gibt es keine grossen Überraschungen.
Für Fans der Serie ist das ein Segen. Für Neulinge könnte es ein Problem sein. Wer zum ersten Mal durch die Welt von «Katamari» rollt, wird möglicherweise von der steilen Lernkurve und den engen Zeitlimits abgeschreckt. Das Spiel macht es Rookies nicht leicht, den Charme zu entdecken, der unter der oftmals frustrierenden Oberfläche liegt.
Wer sich aber die Zeit nimmt und «Once Upon a Katamari» eine Chance gibt, wird mit einem der spassigsten und ungewöhnlichsten Spielerlebnissen überhaupt belohnt. «Katamari» war noch nie perfekt. Und genau das ist irgendwie der Punkt.
Pro
- endloser Charme und ganz viel Persönlichkeit
- simples, suchterzeugendes Gameplay
- grossartiger Soundtrack
- der King of All Cosmos
- ein Feel-Good-Game durch und durch
Contra
- zickige Kamera
- gewöhnungsbedürftige Steuerung
- technisch nur Mittlemass
- Zeitlimits können frustrieren
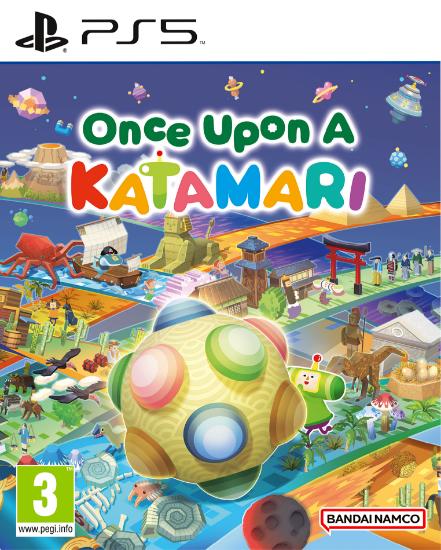
In den frühen 90er-Jahren vererbte mir mein älterer Bruder sein NES mit «The Legend of Zelda» und startete damit eine Obsession, die bis heute anhält.
Welche Filme, Serien, Bücher, Games oder Brettspiele taugen wirklich etwas? Empfehlungen aus persönlichen Erfahrungen.
Alle anzeigenDiese Beiträge könnten dich auch interessieren

Kritik
«Resident Evil Requiem» ist das erhoffte Horror-Meisterwerk
von Domagoj Belancic

Kritik
Gelungenes Upgrade: «Kirby und das vergessene Land – Nintendo Switch 2 Edition + Die Sternensplitter-Welt» überzeugt
von Kevin Hofer

Kritik
Brutal, blutig, bockschwer: «Ninja Gaiden 4» im Test
von Domagoj Belancic